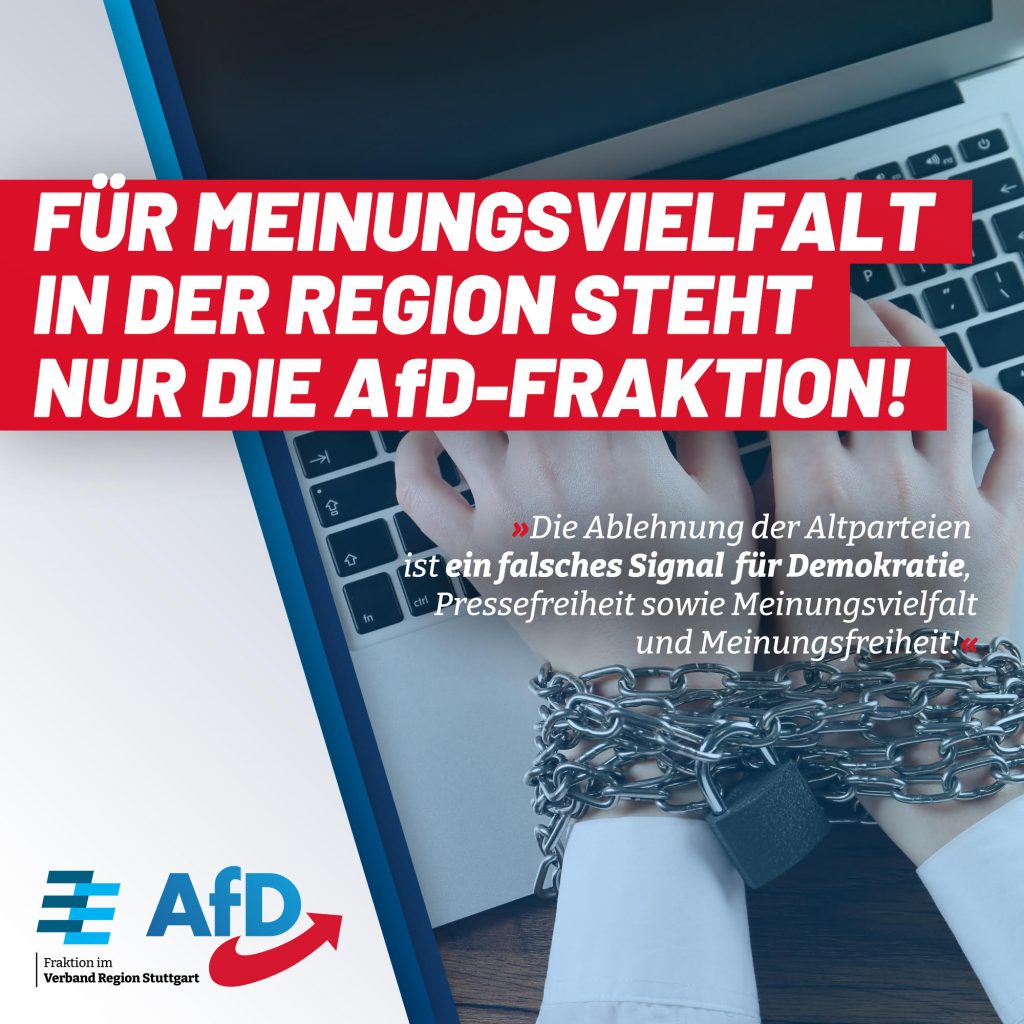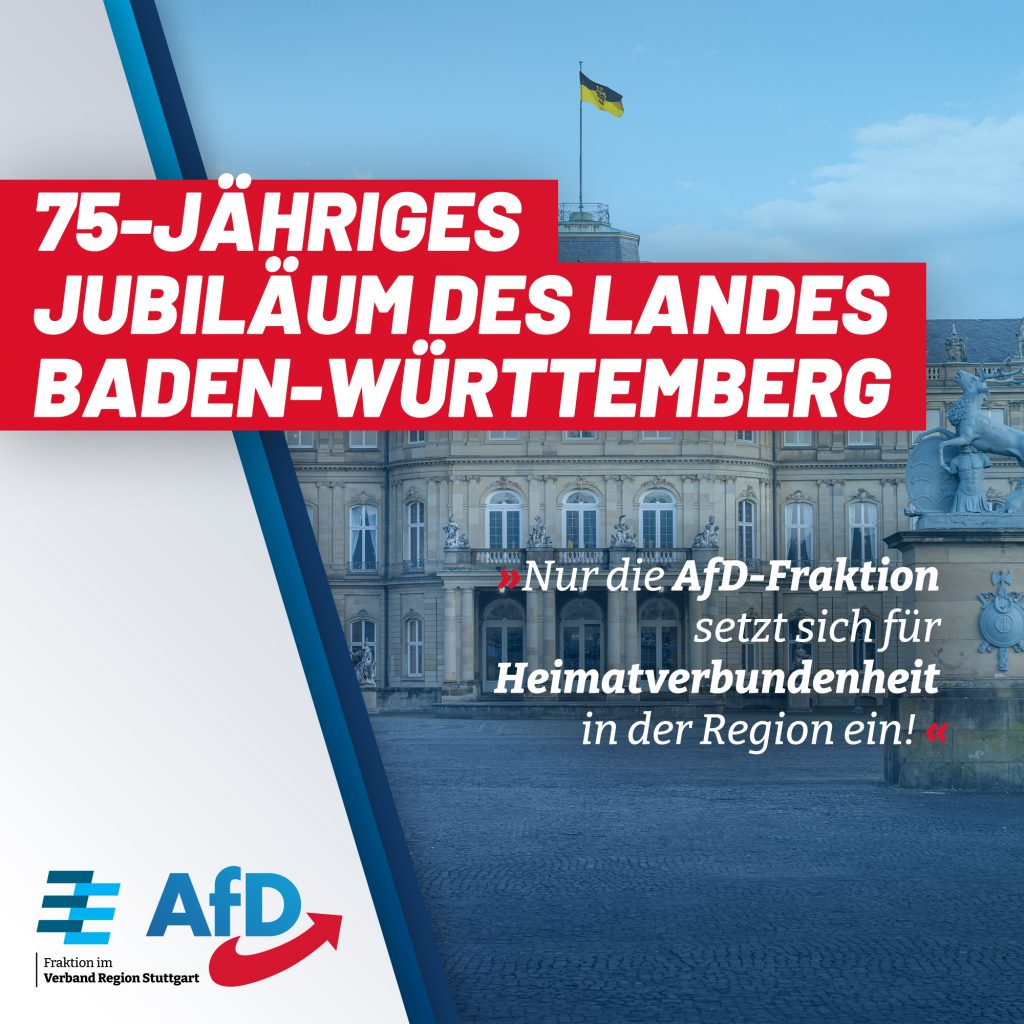Regionsweiten Handwerkerparkausweis endlich umsetzen
❌ Abermals abgelehnt: Ein regionsweiter Handwerkerparkausweis lässt weiter auf sich warten! Trotz klarer Faktenlage wurde unser Antrag erneut abgelehnt. Dabei wäre ein regionsweiter Handwerkerparkausweis längst überfällig. Auffällig: Auch Fraktionen, die sonst für den Handwerkerparkausweis sind, haben abermals geschlossen dagegen gestimmt! 🔧 Die Realität:Handwerksbetriebe arbeiten kreisübergreifend. Die praktische Arbeit hält sich nicht an künstliche Grenzen.Mehrere Landkreise…
Regionales Kompetenzzentrum für Kernenergetik
Antrag abgelehnt: Regionales Kompetenzzentrum für Kernenergetik in der Region StuttgartUnser Antrag, ein Kompetenzzentrum für Kernenergetik, Reaktortechnik und Materialforschung in der Region Stuttgart aufzubauen, wurde ohne Debatte abgelehnt. Die Region droht damit in diesem wichtigen Bereich den Anschluss zu verlieren.Unser Antrag ist ein wichtiger Schritt, um Innovation, Forschung und Nachwuchsförderung zu stärken. Auch Fraktionen, die neuerdings…
Für Meinungsvielfalt in der Region steht nur die AfD-Fraktion!
❌ Antrag ohne Debatte abgelehnt: Sicherung von Arbeitsplätzen und Meinungsvielfalt in der Region Stuttgart Unser Antrag, die Folgen der zunehmenden Zeitungskonzentration in der Region Stuttgart transparent zu machen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln, wurde abgelehnt. Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit sind offensichtlich nur der AfD-Fraktion wichtig! Dabei geht es um zentrale Zukunftsfragen: 📰 Was passiert mit den Arbeitsplätzen…
Dieser Haushalt ist kein Haushalt für morgen!
Die AfD-Fraktion lehnt den Regionalhaushalt 2026 ab. Er scheitert an den zentralen Fragen unserer Zeit. Es fehlt an Innovationskraft, wirtschaftlicher Weitsicht und Vorbereitung auf die drohenden wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Landes- und Bundespolitik. 💔 Ein Haushalt der kalten Herzen: Während für alles Mögliche Gelder in rauen Mengen fließen, ist ein Betrag von 50.000 Euro für…
Förderung eines Kulturprojekts zur jenischen Kultur in der Region Stuttgart
Unser Antrag zur Förderung eines Kulturprojekts zur jenischen Kultur in der Region Stuttgart wurde ohne Debatte abgelehnt. Lediglich ein Vertreter einer anderen Fraktion nörgelte themenfremd herum. Wir wollten für 2026 die KulturRegion Stuttgart beauftragen, mit Wissenschaft, Kultureinrichtungen und der jenischen Gemeinschaft ein Projekt zu entwickeln, das die Geschichte, Kultur und Gegenwart der Jenischen in unserer…
75-jähriges Jubiläum des Landes Baden-Württemberg
Unser Antrag für ein kulturelles Jubiläumsprogramm zum 75-jährigen Bestehen Baden-Württembergs wurde abgelehnt. Natürlich ohne Debatte. Dabei bietet 2027 eine große Chance für die gesamte Region Stuttgart. Wir sehen im 75-jährigen Landesjubiläum die hervorragende Möglichkeit, Vielgestaltigkeit, Geschichte und Zukunft unserer Region für möglichst viele Bewohner der Region zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Das Konzept hätte…